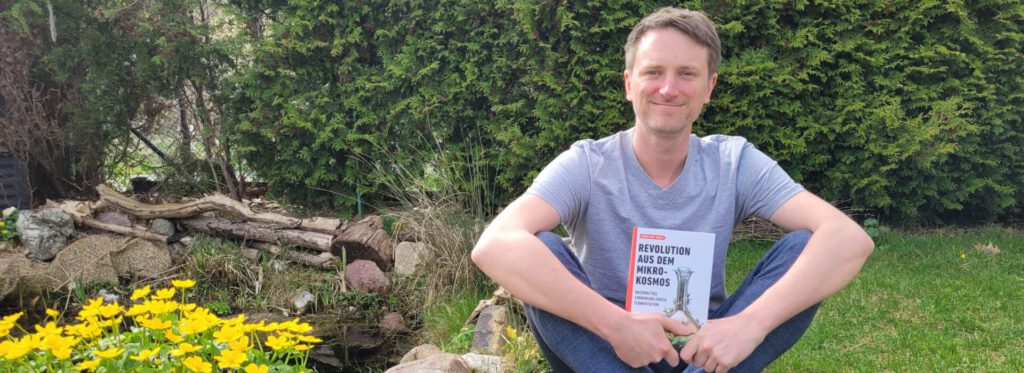Hallo, mein Name ist Martin Reich und ich freue mich, dass Du auf meine Webseite gefunden hast. Ich möchte hier zeigen, für welche Themen ich brenne und für welche Projekte ich mich engagiere. Dazu gehört natürlich auch eine „Über mich“-Seite, also los geht’s:
Von der Naturliebe zur Biologie
Geboren 1984 in Frankfurt am Main habe ich durch lange Wanderungen mit meinem Opa in den Bergen Österreichs und durch Bücher über Tiere und Pflanzen mein Interesse für die Natur entdeckt. Später äußerte das sich darin, dass ich mit etwa zwölf Jahren damit begann, den Regenwald retten zu wollen (wahrscheinlich ein typisches Symptom bei Kindern in den 90er Jahren? Kann jemand ähnliches berichten?). Unter anderen malte ich Cartoons, die von den „Grünen Rächern“ handelten und die mir Familienmitglieder abkaufen mussten, natürlich für eine selbst ausgedachte Währung mit eigenen Scheinen. Später beschloss ich dann, noch immer beeinflusst durch meine Leidenschaft für die Natur und ihren Schutz, an der Goethe-Universität in Frankfurt Biologie zu studieren. Zunächst dachte ich, es würde mich in Richtung Ökologie ziehen, doch es verschlug mich in eine Disziplin namens Ökophysiologie der Pflanzen. Diese bringt auf ganz wunderbare Weise die Funktionsweise von Pflanzen in Interaktion mit ihrer Umwelt zusammen. Also wie sich Pflanzen mithilfe ihrer unterschiedlichen Organe (Blätter, Wurzeln usw.) und auf zellulärer Ebene an Veränderungen in ihrer Umwelt anpassen. Dabei kommen viele unterschiedliche Methoden zum Einsatz und man bewegst sich zwischen den Disziplinen Physiologie, Zellbiologie, Genetik und Ökologie. Rückblickend wundert es mich nicht mehr, dass ich in diese Richtung ging, denn heute weiß ich, dass ich eher ein Generalist als ein Spezialist bin: immer, wenn es zu speziell wird, lasse ich mich zu sehr vom Interesse an anderen Dingen ablenken, in die man doch auch mal hineingucken könnte. Diese Eigenschaft spiegelte sich auch in meiner Promotion wieder, für die ich 2011 in die Niederlande nach Groningen ging. Im Rahmen meiner Forschung beschäftigte ich mich nun mit der Ernährung von Pflanzen, erneut in Interaktion mit Umweltfaktoren, genauer gesagt mit dem Einfluss von Klimawandel auf die Nährstoffaufnahme und -Verteilung in Pflanzen. Noch genauer gesagt habe ich unterschiedliche Kohlsorten erhöhten Konzentrationen von Kohlenstoffdioxid ausgesetzt und gleichzeitig die Temperatur und die Nährstoffe verändert, welche die Pflanzen in ihrer Nährlösung bekamen. Dabei kamen allerlei spannende Dinge heraus, die ich publizieren konnte (findet man auf ResearchGate, falls sich jemand genauer dafür interessiert). Auch hier habe ich mir innerhalb eines Themenspektrums ganz unterschiedliche Dinge angesehen, statt einem Pfad immer tiefer in die Materie zu folgen. Und sowohl während des Studiums als auch meiner Doktorarbeit habe ich mich in der Uni anderweitig unterhalten: zum Beispiel eigene Symposien am Institut initiiert, eine Debatte zwischen Doktoranden und dem Evolutionsbiologen Richard Dawkins organisiert.
Von der Biologie zur Bioökonomie und Wissenschaftskommunikation
Für einen Wissenschaftler ist der fehlende Wille, sich zu spezialisieren, eher hinderlich. Doch als ich die Uni nach meiner Promotion verließ und 2016 nach Berlin ging, kam mir genau diese umtriebige, generalistische Herangehensweise zugute. Nachdem ich einige Monate nach einem Job gesucht hatte, bekam ich nämlich einen Rückruf von der Geschäftsstelle des Bioökonomierats der Bundesregierung. Ja, so habe ich damals auch geguckt. Bioöko…was? Es stellte sich heraus, dass Bioökonomie das Konzept einer nachhaltige Kreislaufwirtschaft ist, die auf biologischen Ressourcen und Wissen basiert und dass es ein Gremium von Expertinnen und Experten unterschiedlicher Disziplinen gibt, die unterschiedliche Bundesministerien und die Regierung dabei berieten, wie eine Umsetzung gelingen könnte. Die Geschäftsstelle, bestehend aus mir und drei Kolleginnen, arbeitete dem Gremium auf unterschiedlichste Weise zu: wir bereiteten Textentwürfe für die Empfehlungspapiere vor, recherchierten und besuchten Veranstaltungen, um immer auf dem neuesten Stand zu sein. Führten die Ratssitzungen durch, organisierten Workshops und Konsultationen und schließlich auch ganze Konferenzen, bei denen sich die internationale Bioökonomie-Community traf. Außerdem konzipierten wir unterschiedliche Kommunikationsformate, mit denen die das Konzept der Bioökonomie der Bevölkerung vermittelt wurde. Zum Beispiel Ausstellungen mit allerlei innovativen Produkten, wie zum Beispiel Handtaschen aus Apfelleder, Lebensmittel aus Algen oder Baustoffe aus biologischen Reststoffen. Und wichtige Forschungsfelder, die unsere Wirtschaft und unser Leben nachhaltiger machen können, wie Ansätze aus der synthetischen Biologie, kleine Roboter für die Feldarbeit, präzisere Pflanzenzüchtung oder Lebensmittel aus Mikroorganismen. Ein unglaublich weites und spannendes Themengebiet, das neueste Forschung mit unserem ganz konkreten Alltag in Verbindung bringt. Bis 2020 hatten wir die Geschäftsstelle des Rates bei uns in der Firma (BIOCOM) ansässig. Anschließend durfte ich meine Begeisterung für diese Themen und die Kommunikation in einem anderen Projekt einsetzen, der Umsetzung der Informationsplattform bioökonomie.de für das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Schaut gerne mal vorbei auf www.bioökonomie.de oder auch unserem gleichnamigen YouTube-Kanal. Wir nutzen vielfältige Kommunikationsmittel, um das Thema Bioökonomie in all seinen Facetten zu erklären und zur Diskussion zu stellen. 2021 hatten wir, zum Beispiel, eine große, fünfwöchige Ausstellung namens „NaturFutur – Bioökonomie erleben“ im Museum für Naturkunde Berlin.
(Brett)spiele als Werkzeug für Kommunikation
Alles fing an mit einem Commodore 64 und Brettspielen wie „Rettet den Regenwald“ und „Agathas letzter Wille“. Analoge Spiele wurden in meiner Jugend von digitalen vollständig verdrängt, sobald wir in den 90ern den ersten PC im Keller stehen hatten, später brachten die Kumpels für nächtelange LAN-Parties ihre Computer zu uns (bzw. ihre Eltern brachten sie mit dem Auto) und ich war einer von denen, die beim Erscheinen von World of Warcraft fast ihre ersten Semester in den Sand gesetzt hätten. Da ich durch Studium und Arbeit ohnehin schon so viel vor dem Schirm saß, kam mir die Renaissance des Brettspielens sehr gelegen. Ab 2012 begann ich damit, moderne Brettspiele zu spielen und eine wachsende Sammlung füllt seitdem meine Regale. Eine wunderbare Art, um mit anderen zu spielen, ohne dabei auf einen Bildschirm zu starren.
Doch es ist mehr als das. Spielen kann ein wunderbares Mittel der Kommunikation sein. Inzwischen gibt es Brettspiele zu fast allen Themen. Ich habe einige Blogartikel geschrieben, in denen ich beides verbinde: Bilden Brettspiele über Bienen die Realität gut ab? Darüber habe ich zum Beispiel mit einer Bienenexpertin gesprochen. Welche Spiele über Natur gibt es? Darüber habe ich auf einem Naturblog geschrieben. Gibt es Spiele über Bioökonomie? Für einen Beitrag auf bioökonomie.de habe ich solche zusammengestellt. Im Januar 2024 konnte ich dann endlich die erste eigene Veranstaltung umsetzen: ein Brettspielabend im Sauriersaal des Museum für Naturkunde Berlin statt, bei dem ich gemeinsam mit Projektpartnern Darwin und seine Reisen anhand von Brettspielen erlebt und diskutiert haben. Organisiert von mir und anderen Mitgliedern des „Netzwerk Naturwissen“ gemeinsam mit dem Projekt Boardgame Historian. Hier gibt es ein schönes Kurzvideo zum Projekt:
Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.
Learn more in YouTube’s privacy policy.
Ehrenamtliches Engagement für evidenzbasierte Nachhaltigkeit
Seit 2019 habe ich damit begonnen, mich auch außerhalb der Arbeit für einen konstruktiven Diskurs über eine nachhaltigere Welt einzusetzen. Mit der Initiative „Progressive Agrarwende“ gründete ich gemeinsam anderen eine Plattform für einen Austausch über Agrarwende hin zu einer nachhaltigeren Landwirtschaft. Und zwar eine, die sich mit den Naturwissenschaften aussöhnt und Methoden, die laut diesen einen großen Beitrag leisten könnten, nicht kategorisch ausschließt, wie es die meisten Umweltorganisationen und der Ökologische Landbau tut. Dazu gehören vor allem auch die neuen Methoden der Pflanzenzüchtung, wie CRISPR/Cas9. Wir setzen uns seitdem dafür ein, dass das Gentechnikrecht in der EU so angepasst wird, dass diese neue und viel präzisere Methode, um Pflanzen zu züchten, auch wirklich zum Einsatz kommt. Schaut gern mal auf unserem Blog vorbei, dort haben sich inzwischen viele interessante Beiträge angesammelt, einige auch von mir. In ihnen dreht es sich meist um neue Möglichkeiten, sich nachhaltiger zu ernähren, denn dieses Thema fesselt mich seit meiner Arbeit für den Bioökonomierat. Wie können wir unserem Konsum so umstellen, dass wir auf nichts verzichten, aber viel weniger Ressourcen verbrauchen als heute? 2020 haben wir dann einen Verein gegründet, um unsere Aktivitäten auf offiziellere Füße zu stellen. Inzwischen zählt das Öko-Progressive Netzwerk e.V. über 60 Mitglieder und ist auch thematisch breiter aufgestellt. Mit gleichgesinnten, neuen Umweltorganisationen in ganz Europa haben wir die Dachorganisation WePlanet gegründet, mit der wir Aktivitäten koordinieren und schlagkräftiger machen. In beiden Vereinen bin ich momentan Teil des Vorstands.
Faszination Fermentation: mein erstes Buch
Meine Forschung daran, wie sich Pflanzen ernähren und wie der Klimawandel dies beeinflusst, meine Arbeit für den Bioökonomierat, während der ich mich intensiv mit alternativen und nachhaltigeren Arten der Lebensmittelproduktion auseinandersetzte und schließlich meine eigene Leidenschaft für das Kochen haben sich nach und nach zu einer allgemeinen Leidenschaft für das Thema „Ernährung der Zukunft“ entwickelt. Neben Insekten, Algen und allerlei pflanzlichen Alternativen, die ich alle probiere, wenn ich sie in die Finger kriege, steht für mich seit einiger Zeit vor allem die Wiederentdeckung der Fermentation im Fokus. Also der Nutzung von Mikroorganismen für unsere Ernährung. Eine uralte Tradition, die für die Entstehung unserer Gesellschaften von zentraler Bedeutung war und die seitdem eher ein Schattendasein führt, obwohl wir sie für die Herstellung zahlreicher, alltäglicher Lebensmittel nutzen. Seit einigen Jahren trifft diese Tradition nun auf die moderne Biotechnologie und daraus entsteht etwas, dass sich als Rettungsanker entpuppen könnte! Denn wir verbrauchen heute viel zu viel Fläche für unsere Ernährung, vor allem für die Herstellung tierischer Lebensmittel. Dieser Flächenverbrauch stellt die größte Gefahr für die globale Artenvielfalt dar. Die Produktion essbarer Mikroorganismen und ihre Nutzung für die Produktion naturidentischer Milchproteine, Eiweiß, Palmöl und zahlreicher anderer Lebensmittel mithilfe von Biotechnologie könnte unser Essen radikal nachhaltiger machen. Dieses Thema habe ich in meinem Buch „Revolution aus dem Mikrokosmos – Nachhaltige Ernährung durch Fermentation“ von vielen Seiten kritisch und allgemeinverständlich beleuchtet. Erschienen ist es im Residenz Verlag im März 2024.
Mehr über mein erstes Buch gibts es hier.